|
ASCHIRA als Musikgruppe ist Geschichte. 1995 löste sich die Gruppe auf – und wartet auf ihre Wiedergeburt. Bis dahin ist es sicher nicht nur für eingefleischte Fans interessant zu erfahren, was und wer ASCHIRA war. Hier also ... |
|||
Die ASCHIRA-Story |
|||
|
sehr persönlich erzählt von ANDREAS BROSCH |
|||
 ASCHIRA im September 1995 in Sobernheim |
|||
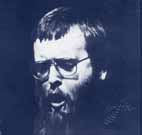 Jan Vering |
Mit ihm fing alles an: Jan Vering. Der damalige Gospel-Sänger schickte
uns ein erstes Songbook mit hebräischen Liedern, er lud uns im Herbst
1979 nach Verden ein zu unserem ersten Konzert, und er hat uns in den folgenden
Jahren zu manchem Engagement verholfen. „Pack doch deine Gitarre ein“, sagte Mike Zank am Vorabend dieses ersten Konzerts zu mir. Eigentlich hatte ich nur mitfahren wollen, um den Abend mit meinem neuen Dual-Tapedeck mitzuschneiden; doch so war ich von Anfang an mit dabei: Rund 400 Konzerte in 16 Jahren in ganz Deutschland haben wir in wechselnder Besetzung gegeben – ASCHIRA war in diesen Jahren ein wichtiger Teil unseres Lebens. |
||
1979-1982: Mike, Helmut und Andreas |
|||
 Mike, Helmut und Andreas 1982 in Wetzlar |
Die eigentlichen Anfänge liegen aber noch vor diesem ersten Abend
in Verden an der Aller; Helmut Weber, unser erster Cellist, hat sie bei
vielen Konzerten immer wieder gern erzählt: Mike und Helmut nahmen
an einen Hebräisch-Ferienkurs in Krelingen bei Hannover teil. Eines
Abends wurde im Innenhof des Studentenwohnheims ein Geburtstag gefeiert.
Und weil Mike nicht nur die einfachen hebräischen Chorusse kannte,
die vor dem Unterricht gesungen wurden, sondern auch etliche chassidische
Lieder und Tänze, holte er seine Gitarre und sang. Andere Kursteilnehmer
begannen zu den Klängen von MAJIM, MAJIM um den Brunnen zu tanzen,
und da Helmut „mit den Bewegungen nicht so zurechtkam“, holte er sein Cello
und spielte die bewegten und bewegenden Melodien einfach mit. Die chassidischen
Lieder hatte Mike von Jan Vering bekommen, der hatte ihm ein Songbook aus
Amerika mit 54 Liedern geschickt mit der Bitte: Sing das mal für mich
auf Kassette, ich will sehen, ob da was für mein Programm dabei ist.
Mike sang – und es war der Anfang einer wunderbaren Liebe zu dieser Musik. |
||
 Bei einer Veranstaltung der cfi (Christen für Israel) in Wetzlar 1881 |
Auf Verden folgten etliche Konzerte in ganz Deutschland, viele davon im
Kielwasser von Jan Vering, der sich als Promoter für uns betätigte.
Er und der Pianist und Produzent Johannes Nitsch waren es auch, die auf
der Jubila 1981
dafür sorgten, daß Mike Zank als Newcomer der
christlichen Musikszene entdeckt wurde – weitere Engagements waren die
Folge. Wir traten als „Mike, Helmut und Andreas“ auf, in der ersten Zeit
vorwiegend bei christlichen Gemeinden und Organisationen und auch in vielen
Schulen. Wir waren erstaunt, wie diese Lieder aus fremden Ländern,
in fremder Sprache gesungen, aus einer anderen Kultur und Religion doch
einen unmittelbaren Zugang zu den Herzen vieler Zuhörer fanden – so
wurde es uns immer wieder gesagt. Allerdings haben wir auch sehr viel erklärt
zu den Liedern, so daß anfangs manche Abende eher einem Vortrag glichen
als einem Konzert. Das wurde in dem Moment besser, wo wir stärker auf die musikalische Aussage der Lieder vertrauten – und als wir auch jiddische Lieder in unser Programm nahmen. Initialzündung dafür war die auch heute noch sehr hörenswerte Platte „Jiddische Lieder“ der Gruppe Zupfgeigenhansel. Von da fand „Di grine Kusine“ ebenso Aufnahme in unsere Konzerte wie „Dos Kelbl“, das schön traurige Liebeslied „Oj dortn“ und das wehmütige „Huljet, huljet Kinderlech“. Verstärkt ging es an solchen Abenden nun auch um unsere Beziehung als Deutsche und als Christen zu Judentum und Israel. |
||
1982-1985: Belaute und Utrala aus der Hildastraße |
|||
 Auf der Hochzeit von Rafi Kishon in Köln 1984, v.r.: Andreas Brosch, Mike Zank, Beate Roelcke, Ute Hagelstein, Sibylle Hansen (verdeckt) |
Seit dem Wintersemester ’81 studierten Mike und ich in Heidelberg.
Die Iwrith-Kurse bei der besten Hebräisch-Lehrerin von allen Ruti
Blum halfen uns, die Liedtexte aus Israel besser zu verstehen. Wir beschäftigten
uns jetzt auch mit weltlichen Liedern aus Israel, mit Tanzliedern und der
vielfältigen Folklore, die Juden aus aller Welt bei ihrer Einwanderung
nach Israel mitgebracht hatten. Südamerikanische Lieder von Matti
Caspi etwa brachten mehr Schwung in unser Repertoire. Im Sommer 1982 ging Mike für ein Jahr zum Studieren nach Jerusalem, unsere Musik ruhte in dieser Zeit. Als er zurückkam, brachte er nicht nur viele Lieder mit, sondern auch die Idee für einen Namen unserer Musikgruppe: ASCHIRA, zu deutsch „Ich will singen“. In Psalm 133 heißt es: „Ich will singen dem Herrn mein Leben lang“; wir hatten das Lied mit dem Titel schon von Anfang an im Programm, und nun durfte er in keinem Konzert fehlen. Im Oktober 1983 kam Helmut einmal zu uns nach Heidelberg, und wir machten an diesem sonnigen Nachmittag Straßenmusik in der Nähe des Uniplatzes. Viele Leute blieben stehen, und am Ende lagen 56 Mark im Gitarrenkasten. Als wir aufbrachen, um das Geld in der nächsten Pizzeria auszugeben, stand eine junge Frau aus dem Publikum immer noch da und ging einfach mit uns. Sie stellte sich vor als Beate Roelcke, Studentin der Musiktherapie und ebenfalls Cellistin. Wir könnten uns ja mal treffen und ein bißchen Musik zusammen machen. |
||
 Ein Foto mit Seltenheitswert: Mike ohne Bart, in Münster 1981, links Verena (?), rechts Andreas Brosch, vorne Helmuts Cello |
Es dauerte allerdings ein Vierteljahr, bis wir uns zufällig wiedertrafen:
nach einem Gottesdienst in der Peterskirche. Beate hatte ihre Freundin
Ute Hagelstein dabei, „Ute an der Geige“, wie später auf Plakaten
zu lesen war. Diesmal gingen wir gleich mit in die Hildastraße 6,
wo die beiden wohnten, und aßen dort zu Mittag. Es war der Beginn
einer langen persönlichen und musikalischen Freundschaft mit „Belaute“
und „Utrala“, wie sie sich in einem selbstverfaßten Bilderbüchlein
nannten. Helmut war bei Konzerten immer noch dabei, doch wir machten zu
viert viel Musik, erarbeiteten Arrangements und Vokalsätze – und hatten
einfach viel Spaß miteinander.
Die musikalische Untermalung der Hochzeit des israelischen Schauspielers
Sabi Dor in München (Thomas Fritsch neben mir am Kuchen-Büffet!),
ein Konzert in Heidelberg-Schlierbach im Juni 1984 und eine Tournee durch
Schleswig-Holstein im August waren musikalische Höhepunkte dieser
Zeit. Mehr und mehr wurden wir damals auch von jüdischen Gemeinden und jüdisch-christlichen Gesellschaften eingeladen. Am Anfang stand ein Auftritt beim Bund Jüdischer Studenten in Baden im Dezember 1982 in Heidelberg. Studenten aus ganz Deutschland waren da und wünschten sich an diesem Abend immer mehr Lieder, bis wir nach über zwei Stunden Programm nicht mehr konnten. Die Jüdische Allgemeine schrieb einen wohlwollenden Artikel unter dem Titel „Folklore mit Seele“, und eine ganze Reihe von Engagements in jüdischen Gemeinden und Einrichtungen waren die Folge. Hier sind diese Lieder zu Hause, spürten wir, sie gehören weniger in große Konzertsäle als vielmehr ins Wohnzimmer. „Schira bezibur“, „öffentliches“ oder besser „gemeinschaftliches Singen“, wie es das in Israel sogar im Radio gibt – hier leben diese Lieder wirklich. |
||
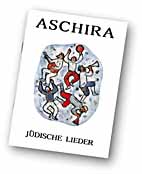 1985 kam das ASCHIRA-Liederheft heraus |
Diese Erfahrung war mit ausschlaggebend für unser nächstes
Projekt: das Liederheft ASCHIRA. Wir wollten die Lieder, die uns selber
so wichtig geworden waren, einem breiteren Kreis zugänglich machen
– zum Selbersingen und nicht zum Hören. Deswegen verwarfen wir ein
alternatives Projekt, nämlich eine Schallplatte aufzunehmen, wofür
uns mehrere Angebote vorlagen. In dieser Zeit beschäftigten wir uns
auch verstärkt mit dem (geistes-) geschichtlichen Hintergrund der
Lieder, ihrem Ort im jüdischen Gottesdienst, mit den Dichtern und
Komponisten. Ein ganzes Semester ging drauf mit dem Suchen geeigneter Lieder,
dem Übersetzen der Texte, dem Forschen nach den Hintergründen,
Bearbeiten der Harmonien und dem Schreiben der Noten und Texte. Die israelische
Künstlerin Lika Tov beauftragten wir, mehrere Lithographien zu den
Liedern zu schaffen. Im Mai 1985 hielten wir das Ergebnis unser langen
Mühen in Händen: das Liederheft, das sich seitdem bald 10.000mal
verkauft hat. Damit die Benutzer des Heftes nicht ganz auf sich und die
Noten gestellt waren, nahmen wir in dem Sommer die Lieder im Studio auf
(69 Lieder in drei Tagen!) und gaben sie als „Übungs-Kassetten“ heraus.
Seit Mai 2000 sind sie als Doppel-CD erhältlich. |
||
1985-1989: Baß muß sein – Geige auch |
|||
 ASCHIRA 1988 bei der Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille (live im ZDF), v.l.: Sigi Meyer, Beate Roelcke, Michael Zank, Andreas Brosch und Thomas Müller |
Als Ute und Beate Examen machten und für ihr Berufspraktikum Heidelberg
verließen, lernten wir Sigi Meyer (Geige) und Thomas Müller
(Kontrabaß) kennen. Auch meine spätere Frau Lisa (damals noch
Schwarz) begann in dieser Zeit mit ihrem glockenhellen Sopran mitzusingen.
Schon vorher war Dorothee Gildemeister (Cello, Percussion und Gesang) dazugestoßen,
manchmal vertreten durch Ina Müller. Verschiedene andere Musiker waren
für einzelne Konzerte mit von der Partie: Irene Barrios (Harfe), Sibylle
Hansen (Violine), Georg Rössler (Querflöte), Michael Schmid (Gitarre
und Gesang).
Durch Mikes Kontakt zu „Studium in Israel“ kamen wir zur „Arbeitsgruppe Juden und Christen“ auf dem Kirchentag. Wir nahmen teil an den Vorbereitungstreffen in Arnoldshain und sangen auf Kirchentagen – auch zusammen mit anderen Musikern wie Dani Bober, Batja Feucht und Daniel Kempin. Bei einem Treffen in Arnoldshain machten wir abends noch Musik, und hinterher kam einer der Referenten, Professor Joseph Walk aus Jerusalem, auf uns zu und sagte: „Daß ihr heute in Deutschland als Christen jüdische Lieder singt, das ist für mich die schönste Rache an Hitler.“ Seine persönliche Rache, fügte er schmunzelnd hinzu, seien seine „acht Kinder und zweiunddreißig Enkel“. |
||
 ASCHIRA ohne Mike Zank 1989, v.l.: Sigi Meyer, Elisabeth Brosch, Andreas Brosch und Ina Müller |
Im Herbst 1988 ging Mike ein zweites Mal für ein Jahr nach Jerusalem,
diesmal als Tutor für die Studenten des Programms „Studium in Israel“.
Als er zurückkam, heiratete er bald darauf eine Amerikanerin und ging
mit ihr in die Vereinigten Staaten; heute lebt er mit seiner Frau Miriam
und seinen beiden Kindern Benjamin und Rachel in Boston. Dort ist er Professor
für neuere jüdische Philosophie. Als Mike ging, übernahm ich die Leitung der Gruppe – für mich ein wichtiger Schritt zur musikalischen Selbstfindung. Das erste Examen lag hinter mir, und ich investierte relativ viel Zeit in die Gruppe, die schon fast zu einem kleinen Orchester angewachsen war. Einen Einschnitt bedeutete die Geburt unserer ersten beiden Kinder Lea (1989) und Miriam (1991), und auch die Übernahme meiner ersten Pfarrstelle in Thaleischweiler beschnitt meine Zeit; doch kurz darauf beschritt ASCHIRA neue musikalische Wege. |
||
1990-1995 ASCHIRA goes Klezmer |
|||
 ASCHIRA 1995 auf dem Kirchentag in Hamburg, v.l.: Elisabeth Brosch, Andreas Brosch, Joachim Hein, Friederuhn Müller und Sven Heidenstecker |
Bei einem Konzert in Heidelberg lernten wir zwei junge Musiker kennen,
die unsere Musik nachhaltig bereichern sollten: den Klarinettisten und
Feidman-Schüler Joachim Hein und den Kontrabassisten Sven Heidenstecker.
Beide studierten, wie seinerzeit Ute und Beate, Musiktherapie in Heidelberg.
Mit Sigi hatten wir schon das eine oder andere Klezmer-Stück gespielt,
aber die Klarinette gehört einfach zu dieser Musik dazu. Und wenn
sie dann aus tiefster Seele gespielt wird, wenn sie singt und lacht, weint
und klagt, hüpft und tanzt, dann kommt diese urjüdische Musik
zu ihrem eigentlichen Wesen. Zu einigen Konzerten brachten die beiden dann
noch ihre Kollegin Friederuhn Müller mit; sie spielte Geige und sang
mit ihrem ausdrucksstarken Alt einige jiddische Lieder. Joachim holte ab
und zu sein Akkordeon heraus, und unser Repertoire wuchs beträchtlich
– nicht zuletzt durch etliche Eigenkompositionen von Joachim, von denen
Feidman meines Wissen mindestens eine eingespielt hat. Zeitweise fiedelte
und sang auch ein Kollege von mir mit: Matthias Helms, heute Pfarrer in
Rodalben und mit seiner Gruppe NASCHUWA
immer noch aktiv in Sachen jüdischer
Folklore. Unser Auftritt auf dem Kirchentag 1995 in Hamburg war dann Höhepunkt und gleichzeitig Abschluß unserer gemeinsamen musikalischen Arbeit: Die drei machten Examen und wurden über ganz Deutschland zerstreut. Das war auch das (vorläufige) Ende von ASCHIRA, denn mit unseren Kindern Nummer drei (Rebecca) und vier (David) wuchsen die familiären Aufgaben dermaßen an, daß kaum Zeit blieb für diese Musik. Einen Teil der jüdischen Lieder bringe ich ein in die Arbeit mit unserem Chor „Schir beMataná“ hier in Thaleischweiler, aber bis sich wieder Musiker finden, die diese Musik spielen (und auch noch im Raum Pirmasens/Kaiserslautern wohnen), wird ASCHIRA wohl noch eine Weile auf Eis liegen – hoffentlich nicht, bis der Prophet Elia kommt. |
||